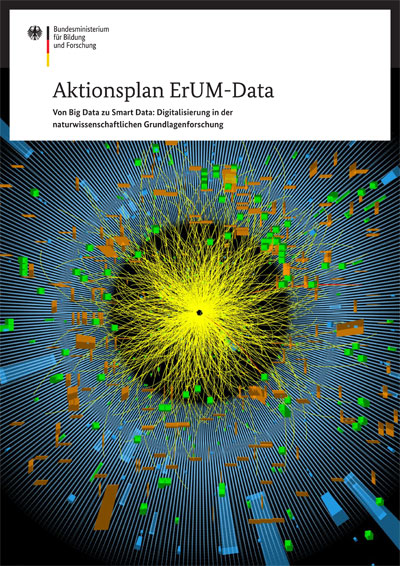Die Beteiligung vom ETP am ErUM-Data-Aktionsplan der BMFTR
Ab dem 1. November 2025 beteiligen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Karlsruhe Center for Elementary Particle and Astroparticle Physics (KCETA) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) an insgesamt sechs neuen Verbundprojekten zur Digitalisierung in der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung und bringen Expertinnen und Experten aus Physik, Informatik und Ingenieurwissenschaften zusammen. Mit der Förderlinie ErUM-Data schafft das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) den Rahmen, um das Potenzial von Daten und Digitalisierung bei der Erforschung von Universum und Materie an großen Forschungsinfrastrukturen voll auszuschöpfen. Der Schwerpunkt liegt auf der interdisziplinären Entwicklung und dem Transfer digitaler Werkzeuge und Kompetenzen.
Zwei der sechs Verbundvorhaben werden vom Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) am KIT koordiniert. Die beteiligten KCETA-Institute, darunter neben dem ETP das Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV), das Institut für Astroteilchenphysik (IAP), das Institut für Beschleunigerphysik und Technologie (IBPT) und das Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE), erhalten insgesamt 3.1 Millionen Euro Fördermittel für ihre Teilprojekte. Neben den geförderten Partnerinstitutionen beteiligen sich oft weitere assoziierte Partner an den Verbundprojekten. Diese Einrichtungen bringen wissenschaftliche Expertise, Daten oder Infrastruktur in die Zusammenarbeit ein, erhalten jedoch keine eigenen Fördermittel. Ihre Mitwirkung erweitert die wissenschaftliche Reichweite der Projekte oder stärkt den Wissenstransfer zwischen Grundlagenforschung und angewandter Technologieentwicklung.
Verbundprojekt „Steigerung der Dateneffizienz in eingebetteten Prozessoren durch künstliche Intelligenz“ (DEEP)
Der Forschungsverbund DEEP wird von Prof. Dr. Torben Ferber am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) koordiniert und entwickelt neue Lösungen für ultraschnelle Echtzeit-KI. Am KIT sind das Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) sowie das Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV) unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Jürgen Becker beteiligt. Ziel ist es, die entwickelten Technologien an Großforschungsanlagen einzusetzen und langfristig für Wissenschaft und Industrie nutzbar zu machen.
Im Fokus stehen eingebettete Parallelprozessoren und System-on-a-Chip-Hardware der nächsten Generation, insbesondere die AMD Versal-Architektur. Neu und strategisch bedeutsam ist die enge Zusammenarbeit mit SiMa.ai Deutschland (Stuttgart) als Industriepartner, die den Transfer modernster KI-Technologien aus der Forschung in industrielle Anwendungen stärkt und zum Aufbau nachhaltiger technologischer Kompetenzen in Deutschland beiträgt.
Weitere Partner im Verbund sind die Technische Universität Hamburg, die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg sowie die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Die entwickelten Lösungen werden bei Belle II, LHCb, AMBER, ESS, European XFEL und PETRA III/IV unter realen Bedingungen getestet.
Assoziierte Partner bei DEEP sind die SICK AG (Waldkirch) sowie das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY (Hamburg).
Verbundprojekt „Domänenübergreifende Vernetzung: KI-basierte, detektorunabhängige Rekonstruktions-Frameworks für hochdimensionale, topologisch komplexe Daten“ (BRAID)
Der Forschungsverbund BRAID, koordiniert von Prof. Dr. Jan Kieseler am KIT, entwickelt neuartige KI-Methoden für die datengetriebene Rekonstruktion in der Teilchen-, Hadronen- und Astroteilchenphysik. Ziel ist ein detektorunabhängiges („agnostisches“) Framework, das komplexe Sensordaten mittels Graph- und Transformer-Netzwerken effizient verarbeitet und dabei physikalische Gesetzmäßigkeiten respektiert.
Durch adaptive Dimensionalitätsreduktion und offene, standardisierte Datensätze werden domänenübergreifende Anwendungen von der Grundlagenforschung bis zur Medizintechnik ermöglicht. Weitere Partner sind die RPTU Kaiserslautern-Landau, die TU Dortmund und das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung. Das Konsortium stärkt die Brücke zwischen Physik und Informatik und leistet einen Beitrag zu nachhaltiger, offener und energieeffizienter KI-gestützter Wissenschaft.
Assoziierter Partner ist die inomed Medizintechnik GmbH (Emmendingen).
Verbundprojekt „Nachhaltige Föderierte Compute-Infrastrukturen“ (SUSFECIT)
Der Forschungsverbund SUSFECIT, koordiniert an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, erforscht neue Konzepte für ein energieeffizientes Rechenzentrumsmanagement in enger Zusammenarbeit mit dem GridKa am Scientific Computing Center (SCC). Im Mittelpunkt steht die Entwicklung eines „atmenden Rechenzentrums“, das Rechenkapazitäten dynamisch an die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien anpasst.
Durch intelligente Orchestrierung und die Optimierung von CPU-Taktfrequenzen sollen Energieverbrauch und CO₂-Fußabdruck deutlich reduziert werden. Die auf dem Ressourcen-Meta-Scheduler COBalD/TARDIS basierenden Entwicklungen fließen in internationale Infrastrukturen wie das Worldwide LHC Computing Grid ein und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Digitalisierung der Wissenschaft.
Weitere Partner im Verbund sind die RWTH Aachen University, die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, das DESY, die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, die Georg-August-Universität Göttingen und das Öko-Institut e.V.
Assoziierte Partner sind das CERN (Genf) sowie am KIT das Institut für Astroteilchenphysik (IAP), das Institut für Beschleunigerphysik und Technologie (IBPT) und das Scientific Computing Center (SCC).
Verbundprojekt „Auf dem Weg zu schnellen Feedback-Mechanismen und autonomen Experimenten in der Synchrotron- und Neutronenforschung“ (FASTER)
Das Verbundprojekt FASTER, koordiniert an der Universität Siegen, hat das Ziel, autonome und unbeaufsichtigte Experimente in der Synchrotron- und Neutronenforschung zu entwickeln, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu beschleunigen und die Strahlzeit effizienter zu nutzen. Ergebnisse werden über den ErUM-Data Hub zugänglich gemacht, um Kooperationen in der Wissenschaft zu fördern. Gleichzeitig wird eine Industriepartnerschaft angestrebt, um die entwickelten Technologien auch in anderen Bereichen nutzbar zu machen. Das Projekt verwirklicht erste Schritte hin zu autonomen Experimenten in der Synchrotron- und Neutronenforschung, um damit Forschungseffizienz und Datenqualität zu steigern.
Das Laboratorium für Applikationen der Synchrotronstrahlung in der Beschleunigerphysik und das Institut für Beschleunigerphysik und Technologie (IBPT) tragen im Projekt und in Kooperation mit den Verbundpartnern mit Machine-Learning-Algorithmen, deren Optimierung, FPGA-basierter Datenanalyse und Steuerung sowie mit schnellen Kontrollsystemen an Beschleunigern und deren Übertragung bei.
Partner im Verbund sind neben der Universität Siegen und dem KIT, die Eberhard Karls Universität Tübingen, die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, das Helmholtz-Zentrum hereon GmbH, das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY) sowie das Unternehmen TXproducts UG in Hamburg.
Verbundprojekt “Informationsfeldtheorie für Experimente an Großforschungsanlagen” (ErUM-IFT2)
Das Verbundprojekt ErUM-IFT2, koordiniert am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching, baut auf den Erfolg des zuvor geförderten ErUM-IFT-Projekts auf und befasst sich mit der Anwendung von Methoden der Informationsfeldtheorie im Kontext von Experimenten der Großforschung. Das Projekt umspannt dabei ein breites Themenspektrum von der Astroteilchen- und Teilchenphysik über die Radioastronomie bis hin zur Physik der kondensierten Materie.
Am Institut für Astroteilchenphysik (IAP) des KIT liegt der Fokus auf der Entwicklung von hochpräzisen Modellen für die Signalpropagation von Radiowellen in antarktischem Eis durch Verknüpfung von Simulationen mit dem CORSIKA 8 Code mit Methoden der Informationsfeldtheorie. Solche Eismodelle sind die Grundlage für die Suche nach hochenergetischen Neutrinos über ihre Radioemissionen in dichten Medien in Detektoren wie IceCube-Gen2 und dem Radio Neutrino Observatory Greenland (RNO-G).
Partner im Verbund sind neben dem Max-Planck-Institut für Astrophysik das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY), das Forschungszentrum Jülich, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, das Helmholtz-Zentrum hereon, die RWTH Aachen University, die Technische Hochschule Augsburg, die Technische Universität München, die Universität Bielefeld sowie die Universität Hamburg.
Assoziierter Partner ist die Erium GmbH.
Verbundprojekt “MorphoSphere – The Smart, Interactive Repository for Digitized Morphology”
Das Verbundprojekt MorphoSphere, koordiniert vom Laboratorium für Applikationen der Synchrotronstrahlung (LAS) am KIT, hat die Vision intelligente, interaktive Datenspeicher- und Analyse-Repositorien aufzubauen. Als Pilotanwendung wird die 3D-Bildgebung als eine wichtige Analysemethode in vielen Anwendungsbereichen betrachtet. Derzeit werden hier Petabytes an Rohdaten erzeugt, die einen Datenstau im Analyseprozess darstellen und den wissenschaftlichen Fortschritt in vielen Anwendungsbereichen verlangsamen. Um diesen Engpass zu überwinden, haben sich datenerzeugende Großgeräte, Daten- und Rechenzentren sowie wissenschaftliche Communities zusammengeschlossen.
KCETA-Wissenschaftler vom Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) und vom Scientific Computing Center (SCC) realisieren im Projekt MorphoSphere ein verteiltes Big Data Management, das Speichersysteme miteinander virtuell verbindet. Sie implementieren eine effiziente Datenorganisation und Datenreduktion und entwickeln neue Ansätze für verteiltes maschinelle Lernen, die darauf abzielen, das Problem zu großer Datensätze für einen einzelnen Grafikprozessor zu überwinden, indem domänen-parallele neuronale Netze entwickelt werden.
Partner im Verbund sind neben dem KIT die Universität Heidelberg und das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY). 20 assoziierte nationale und internationale Partner, bestehend aus Forschungseinrichtungen, Synchrotronstrahlungsquellen und Museen, komplettieren den Verbund.